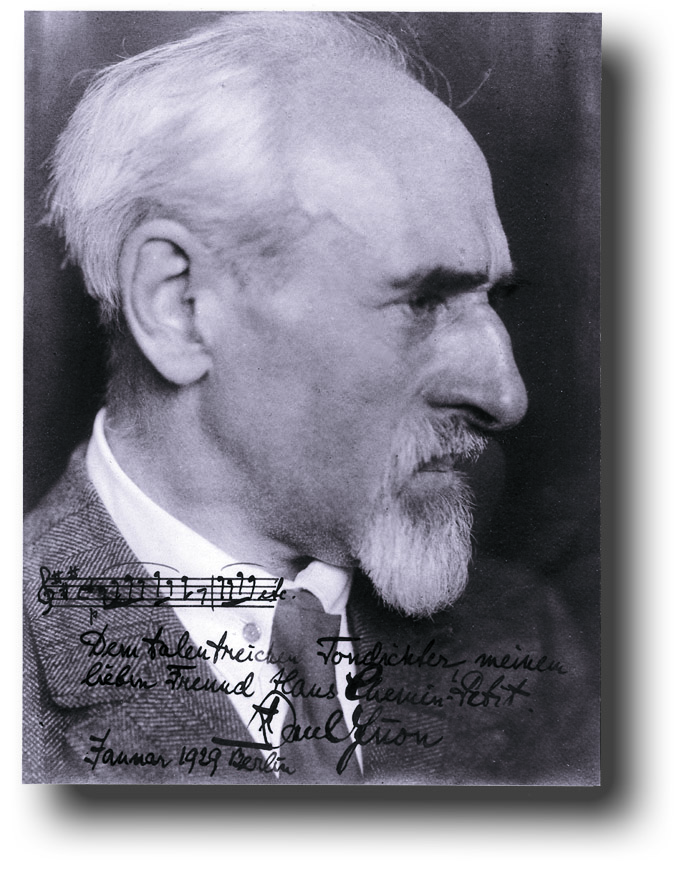Das Phänomen der bewußten Wiederverwendung musikalischer Formulierungen außerhalb des Kontextes, für den sie geprägt wurden, hat schon viele Generationen von Musikliebhabern und -forschern fasziniert. Bei manchen Menschen ist die Wiederhörensfreude so groß, daß sie fast zwanghaft der Sucht erliegen, in kriminalistischer Kleinarbeit überall tatsächliche oder vermutete Zusammenhänge aufzuspüren und sie auf mehr oder weniger gewagte Weise hermeneutisch zu deuten. Brahms hat zwar mehrmals seinen Unmut über diese musikalische Reminiszenzenjagd bekundet, hat aber den sie provozierenden Kunstgriff keineswegs verschmäht. Im Gegenteil: es gibt wenige Komponisten, von denen die vielschichtigen Evokationsmöglichkeiten solcher „Transplantationen“ so subtil und so effizient genützt wurden wie von Brahms.
In den hundert Jahren, die uns von Brahms trennen, hat dieses Phänomen an absoluter Häufigkeit und an spezifischem Gewicht innerhalb einzelner Werke zugenommen. In manchen Fällen, etwa im Œuvre von Bernd Alois Zimmermann, hat es sogar dominante Bedeutung gewonnen. Diese unüberhörbare Entwicklung kann in verschiedenster Weise gedeutet werden. So wurde argumentiert, daß das Zitat in seiner semantischen Polyvalenz der Musik Mitteilungsebenen zurückgewinnen könne, die ihr in Abwesenheit einer verbindlichen idiomatischen Norm sonst verloren gingen – in dieser Deutung wird das Zitat zum Ausweg aus der Sprachlosigkeit.[i] Verbreiteter dürfte hingegen die kulturpessimistische Annahme sein, die Vorliebe für das Zitat sei ein Symptom für das Nachlassen originaler schöpferischer Fähigkeiten. Diesem modischen Lamento wäre vielerlei entgegenzuhalten: vor allem aber die beweisbare Tatsache, daß alle uns bekannten Hochkulturen mit zunehmendem Alter eine Vorliebe für jene künstlerische Verfahren entwickelt haben, die es ermöglichen, den angesammelten Ideen-, Formen- und Bilderreichtum in assoziativer Weise zu nützen; und daß viele der beeindruckendsten Kulturleistungen der Menschheit Produkte solch „eklektischer“ Phasen sind.
Die weite Verbreitung, die die verschiedenen Verfahren der Wiederverwendung musikalischer Antefacta in der jüngeren und jüngsten Musikgeschichte gefunden haben, hat das Erscheinen einer Reihe methodischer Arbeiten und Materialsammlungen sowie einer Vielzahl spezieller Untersuchungen zu diesem Phänomen veranlaßt. Es liegt in der Natur solcher musikwissenschaftlicher Arbeiten und entspricht ihrer Zielsetzung, daß die gewählte Perspektive entweder (bei den grundlegenden Studien) sehr allgemein oder aber (bei den detaillierten Abhandlungen) sehr konkret ist. Die hier kurz skizzierten Gedanken und Bemerkungen zur Brahmsschen Kunst des Zitierens sind demgegenüber aus einem anderen Blickwinkel, nämlich dem des Interpreten, formuliert. Mit der Einnahme dieses Standpunktes nimmt man notgedrungen einige Unschärfen in Kauf. So werden etwa die meisten Interpreten zwar den klaren und nützlichen Begriffsunterscheidungen, die der Methodiker zwischen den verschiedenen Möglichkeiten und Formen der Verwendung von Antefacta trifft, zu folgen vermögen, aber diese Differenzierungen werden im Umgang mit der klingenden Realität des musikalischen Kunstwerkes von sehr untergeordneter Bedeutung bleiben. Der musikalische Text erweckt Assoziationen, auf die der Interpret reagiert. Wie diese Reaktion ausfällt, ist von der Empfänglichkeit des Interpreten für die verschiedenen Bedeutungsebenen dieser Assoziation, mittelbar also sicher auch von seinem Wissen, abhängig. Es ist aber nicht anzunehmen, daß diese Reaktion ihrem Wesen nach das Resultat einer Überprüfung des sie auslösenden Phänomens etwa gemäß den von Zofia Lissa vorgeschlagenen dreizehn Bedingungen für das Vorhandensein eines Zitates[ii] oder den von Kenneth R. Hull formulierten sechs Kriterien für das Vorliegen einer Anspielung[iii] ist. Auch aus diesem Grunde verwende ich hier den Begriff „Zitat“ nicht in seiner streng wissenschaftlichen Bedeutung sondern nur als eine praktische Kurzbezeichnung für die bei Brahms anzutreffenden Spielarten der Wiederverwendung fremder und eigener musikalischer Formulierungen, unabhängig davon, ob es sich dabei um „Zitate“ im engsten Sinne, Anspielungen, Entlehnungen oder Anklänge handelt. Diese letzte Bezeichnung habe ich als Überschrift gewählt, weil sie auch der Titel eines Brahmsliedes (op.7 Nr.3) ist, das, ohne im eigentlichen Sinne zu zitieren, einige der hier berührten Wesenszüge des Brahmsschen Zitates aufweist.[iv]
Wie wohl kein anderer Komponist vor ihm hat Brahms die musikalische Tradition, aus der sein Werk hervorgehen sollte, nicht nur als eine notwendige Vorbedingung seines Schaffens, sondern bewußt auch als eine belastende Hypothek erlebt. Seine berühmten, oft zitierten und fast ebenso oft überinterpretierten Worte von den Schritten des Riesen, die er hinter sich zu vernehmen glaubt, belegen, trotz aller bei der Kommentierung Brahmsscher Äußerungen gebotener Vorsicht, zumindest das Faktum, daß Brahms die eigene Beziehung zu seinen großen Vorgängern nicht nur reagierend, also komponierend, sondern auch reflektierend definierte. Aber auch schon hinter dieser simplen Feststellung lauern jene Mißverständnisse, aus denen die Brahmsrezeption seit jeher zum allergrößten Teil besteht: das Fortspinnen dieses Gedankens könnte zu einer wertenden Gegenüberstellung von agere und flectere verleiten und uns in letzter Konsequenz an der Untiefe des auf Brahms gemünzten Nietzsche-Wortes von der „Melancholie des Unvermögens“ stranden lassen.
Daß für den (sicher nicht geringen) musikalischen Verstand des Wagner-Feindes Nietzsche das Phänomen Brahms zu gewaltig war, soll uns hier nicht weiter beschäftigen; da aber in Nietzsches Verdikt sich ohne Zweifel auch die Meinung des von dem unglücklichen Musiker-Philosophen in Haßliebe umkreisten Zentralgestirns Wagner widerspiegelt, können wir uns einen kurzen Seitenblick auf dessen Urteil über Brahms nicht versagen – wie immer getrübt es spätestens seit der von Brahms mitinitiierten unseligen „Erklärung“ von 1860 auch gewesen sein mag. Wagner schreibt mit überdeutlichem, wenn auch hämisch verzerrtem Bezug auf Brahms:
„Ich kenne berühmte Komponisten, die ihr bei Konzertmaskeraden heute in der Larve des Bänkelsängers (»an allen meinen Leiden«!), morgen mit der Hallelujah-Perrücke Händels, ein anderes Mal als jüdischen Czardasaufspieler und dann wieder als grundgediegenen Symphonisten in eine Numero Zehn verkleidet antreffen könnt.“[v]
Und gerade diese ohnmächtig wutschnaubende Tirade führt uns geradenwegs zum Thema: denn, obwohl Wagner sich hier die Feder von den unverläßlichen Gehilfen Neid und Haß führen hat lassen, trifft er doch mit einer dem Genie oft auch in seinen Fehlurteilen und Verirrungen eigenen Hellsichtigkeit einen Wesenszug der Brahmsschen Musik, der uns hier beschäftigt – nämlich die Kraft der Anverwandlung, die ihr innewohnt und die einen Teil jenes Zaubers ausmacht, gegen den auch der Magier Wagner kein Mittel weiß.
Freilich sind die hier von Wagner verächtlich gemachten Bezugspunkte der Brahmsschen Musik – Beethoven, die barocke Musiktradition und die Volksmusik – nur ein Teilaspekt ihrer evokativen Möglichkeiten; Wagner selbst scheint die Unzulänglichkeit des Angriffs empfunden zu haben, denn einige Zeilen weiter nennt er seinen fiktiven Gegenspieler mit den absichtsvoll überzeichneten Brahmszügen den „Komponist[en] des letzten Gedankens Robert Schumanns“[vi] und berührt damit, taktlos und oberflächlich, eine weit wichtigere Quelle dieser Möglichkeiten. Denn er denkt natürlich an die 1861 (also nicht lange nach dem Eklat um die „Erklärung“) komponierten und Schumanns Tochter Julie gewidmeten vierhändigen Variationen op. 23, in denen Brahms jenes „Geisterthema“ verarbeitet, das Schumann in den Tagen der Februarkatastrophe beschäftigt hatte.[vii] Tatsächlich wollte ja Brahms bei der Herausgabe des Werkes im Titel den Bezug zu jenem vermeintlich „letzten musikalischen Gedanken Robert Schumanns“ herstellen, was er dann, dem Wunsche Claras[viii] entsprechend, unterließ. Wenn ich diesen Anknüpfungspunkt für wichtiger erachte als etwa die zahllosen Querbezüge zum Werk Beethovens, so entspringt diese Einschätzung weder einem quantifizierenden Kalkül noch auch einer ästhetischen Wertung (die in diesem Falle eine die Wagnersche Instinktlosigkeit noch übertreffende Anmaßung wäre). Wichtiger ist diese Quelle vielmehr nur deswegen, weil ihre eigene Natur uns etwas vom Ursprung der Brahmsschen Kunst des Zitierens verrät.
Schumann selbst war nämlich davon überzeugt, daß ihm das ominöse Thema von Schubert und Mendelssohn, die ihn in einer Traumvision heimgesucht hatten, diktiert worden sei; tatsächlich aber entstammt ja das Thema, wie inzwischen hinlänglich bekannt, dem langsamen Satz von Schumanns, kurz davor komponiertem, eigenem Violinkonzert. Es handelt sich hier bei Schumann also um ein vermeintliches Fremdzitat, das in Wahrheit ein Selbstzitat ist. Der schöne und berührende „Selbstbetrug“, der da am Ende von Schumanns Lebenswerk steht, findet seine geheimnisvolle Entsprechung ganz am Anfang seiner kompositorischen Laufbahn: In Schumanns drittem Tagebuch, den Hottentottiana, findet sich folgende, zunächst alltäglich erscheinende, doch bei näherer Betrachtung sehr bemerkenswerte Sequenz:[ix]
Studentenextremitäten am 30sten [November 1828]
Früh bei Wiek – […] Probst von hinten u. von vorne – Trio v. Schubert u. die Kritiker – Wiek´s Ver- u. Entzückung – […] Violinspieler Müller und Grabau Entzükung bey´m Trio –
Dito am 31sten (vulgo 1ster December) [1828]
Mein Quartett – Schubert ist tod – Bestürzung – […] – Aufgefundene Charakteristik meiner selbst u. mein inneres Lächeln.
Dieser Passus ist das flüchtige und verschlüsselte Dokument einer Berufung, die entgegen dem ersten Anschein sehr wohl etwas mit Johannes Brahms zu tun hat: Eingebettet in eine Alltagsszene, deren Nebenfiguren freilich alles andere als zufällig sind, blitzt hier die Erkenntnis eines Vermächtnisses auf. Alles an dieser Konstellation scheint der Feder eines allzu phantasievollen Musikschriftstellers entsprungen: die auf die Begeisterung über das Trio folgende Erschütterung durch die Todesnachricht, die wie zufällige erste Erwähnung von Schumanns eigenem ersten Kammermusikwerk (dem Klavierquartett c-moll), die im Hinblick auf Schumanns weiteren Lebensweg symbolträchtigen Zeugen der Szene[x] und endlich die Selbstfindung, die eine früher versuchte Charakterisierung lächelnd verwerfen kann.
Hier ahnt man ein wenig von jenem Mysterium der innigen Seelenverwandtschaft, das in Schumanns Denken und Leben eine so große Rolle spielt. Und von hier aus werden die Brahms betreffenden Prophezeiungen der „Neuen Bahnen“ erst richtig verständlich: als die bewußte und willentliche Weitergabe eines großen Erbes, das Schumann selbst auf rätselhafte Weise von Schubert empfangen hatte.
Obwohl Schumann selbst seine „Berufung“ zur Schubert-Nachfolge – trotz des poetisch überhöhten Tones der Hottentottiana hat er sich selbst freilich nie zu einer so unmißverständlichen Deutung des Vorganges hinreißen lassen – vielleicht als Gnade, sicher aber nicht als Hypothek empfand, hatte auch er mit dem Genius, der da in ihn gefahren war, zu ringen. Das Scheitern gleich des ersten ehrgeizigen Kammermusikprojektes, eben jenes gewissermaßen aus dem Geiste Schuberts empfangenen Klavierquartetts, ist nur ein beredtes Zeugnis für dieses Ringen.[xi] Aber im allgemeinen darf man wohl sagen, daß Schumann diese gedachte Berufung weit weniger zu schaffen machte als Brahms die persönliche und öffentliche, die ihm durch Schumann widerfahren sollte. Gerade die offenkundigen (und oft diskutierten) Probleme, die diese mit den „Neuen Bahnen“ nach außen hin vollzogene „Inthronisation“ des jungen Komponisten mit sich brachte, scheinen die Entwicklung von Johannes Brahms nachhaltig und auf mehreren Ebenen beeinflußt zu haben.
Die uns hier beschäftigende Ebene, nämlich die Ausprägung einer Brahms eigenen Zeichensprache, in der Zitate eine zentrale Rolle spielen, hat in ganz besonderer Weise mit der sich in diesen symbolhaften Vorgängen widerspiegelnden Filiation Schubert – Schumann – Brahms zu tun. Die spezielle Qualität dieses Zusammenhanges erschließt sich am ehesten, wenn man sich dem Thema in „unwissenschaftlich“-naiver Haltung nähert: indem man sich Brahms-Zitate in Erinnerung ruft, die besonders „treffen“.
Die meisten Hörer werden bei diesem Versuch, sobald sie einmal die anekdotisch überstrapazierten „Oberflächenzitate“[xii] beiseite lassen, wohl unweigerlich bei den Selbszitaten anlangen, mit denen Brahms an unzähligen Stellen seiner Instrumentalkompositionen eigene Lieder heraufbeschwört.
Diese oft konstatierten und kommentierten Querbezüge zwischen dem Vokalwerk und der Instrumentalmusik von Johannes Brahms werden üblicherweise ausschließlich aus dem Blickwinkel des Anekdotischen betrachtet. Brahms selbst scheint für diese Betrachtungsweise ausreichend Anlaß zu geben: Wenn im Finale der nach dem Zeugnis Kalbecks „in Erwartung der Ankunft einer geliebten Freundin“ niedergeschriebenen A-Dur-Sonate op. 100 die Schlüsselwendung eines Liedes (op.105 Nr.2) erscheint, dessen Text mit den Worten „Komm, o komme bald!“ schließt, so drängt sich eine naiv-anekdotische Interpretation dieses Selbstzitates geradezu auf. Fast alle Liedzitate bei Brahms lassen sich recht mühelos auf diese Weise „entschlüsseln“, und dieser Umstand deutet an, daß eine solche Lesung nicht nur legitim, sondern darüber hinaus auch vom Komponisten intendiert ist. Auch wortbezogene Fremdzitate, wie etwa das berühmte (in der Endfassung von 1889 eliminierte) Beethovensche „Nimm sie hin denn, diese Lieder!“ aus dem Schlußsatz des Klaviertrios op. 8, fügen sich scheinbar widerspruchslos einer solchen Deutung. Die wortgebundene Musik wäre demnach ein Art Steinbruch, aus dem der Komponist nach Lust und Laune fertige „Sinnbilder“ herausbricht, um sie – zur Freude des Eingeweihten – im wortlosen Kontext der Instrumentalmusik zur Sprache zu bringen.
Um beurteilen zu können, ob eine solche Sichtweise dem Phänomen zur Gänze gerecht wird, sollte man sich fragen, wo und wie es sich schon vor Brahms manifestiert hat; denn wir wissen aus zahllosen Äußerungen von Brahms, daß er scheinbare „Eigenheiten“ immer wieder mit der Autorität der Tradition verteidigte. Dann aber gilt es zu klären, ob und inwieweit Brahms diesen „Kniff“ vielleicht doch in einer ihm eigenen, von seinen Vorgängern abweichenden Weise einsetzt, und, sollte dies der Fall sein, worauf sich denn diese „typisch Brahmsische“ Verwendung eines tradierten Kunstgriffes gründet.
Die erste Schwierigkeit stellt sich uns freilich schon bei der Definition des zu untersuchenden Phänomens in den Weg. Peter Rummenhöller stellt gleich zu Beginn seines Aufsatzes „Liedhaftes“ im Werk von Johannes Brahms klar, daß es ihm „weder um die Aufspürung konkreter Liedzitate (z. B. besonders deutlich in der Akademischen Fest-Ouvertüre) noch um das allgemein »Kantable« bei Brahms zu tun [ist], denn beides findet sich vor und jenseits unserer Problematik in fast allen Epochen der europäischen Musikgeschichte.“[xiii] Das spezifische Phänomen, um das es auch uns geht, hat wirklich mit der Aufspürung konkreter Liedzitate in der Art der in der Akademischen Fest-Ouvertüre verwendeten nichts zu tun. Diese Liedzitate – im konkreten Fall handelt es sich um Volks- und Studentenlieder, die Brahms wahrscheinlich dem Commers-Buch für den deutschen Studenten von 1861 entnommen hat – belegen eine tatsächlich zu allen Zeiten übliche Praxis des Rückgriffs auf bekanntes und allgemein verbreitetes Melodiengut. Charakteristisch für diese Art des Zitates ist der überpersönlich-emblematische Ton, mit dem es vorgebracht wird. Um diesen Ton überhaupt anschlagen zu können, muß das zitierte Material sich aber auch für eine solcherart „plakative“ Verwendung eignen. Choräle, offizielle und inoffizielle Hymnen, politische Lieder – kurz: alles, was gemeinschaftsbildende Signalwirkung ausstrahlt, ist die Domäne dieser Form des Zitates. Brahmsens Gaudeamus gehört ebenso hieher wie Beethovens God save the King (in Wellingtons Sieg op. 91), Čajkovskijs Hymnenzitate in den Ouverturen op. 15 und op. 49 oder die unzähligen Marlborough und Marseillaise-Zitate in der Musik der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts (und darüber hinaus).[xiv] Beispiele für die Verwendung solcher emblematischen, überpersönlichen Zitate ließen sich tatsächlich in großer Menge aus allen Epochen der Musikgeschichte anführen. Ganz anders steht es aber mit der Erscheinung, die uns interessiert. Die eingangs erwähnten Zitate in Brahmsens Instrumentalwerken sind gewissermaßen individueller, privater Natur. Sie haben sogar, und das scheint für diese Sonderform des Zitates ein konstitutiver Zug zu sein, einen sozusagen „hermetischen“ Sinn: sie wenden sich an einen Eingeweihten, Vertrauten. Als Quelle dieser Art von Mitteilung eignet sich in erster Linie das Kunstlied (als Fremd- oder Selbstzitat) oder ein „intimeres“ Volkslied. Es erstaunt nicht, daß diese Spielart des Zitates erst in der Zeit der Entstehung einer bürgerlichen Musikgesellschaft zur vollen Entfaltung kommt. Im bürgerlichenSalon und in dem sich dort zusammenfindenden vertrauten Freundeskreis bietet sich die Chance, auch mit solchen stillen und verborgenen Zeichen verstanden zu werden. Ebensowenig überrascht es, daß die typischsten Beispiele dieser Zitatform der Kammermusik entstammen, während das schlagendere, auffälligere und meist schon widmungsgemäß für die breite Öffentlichkeit bestimmte Zitat der zuerst erwähnten Art meistens in der symphonischen Musik zuhause ist.
Während Brahms das „plakative“ Zitat nur gelegentlich verwendet, ist das „hermetische“ ein fast allgegenwärtiger Wesenszug seiner Musik. Die Musikwissenschaft hat mittlerweile eine beeindruckende und verwirrende Menge solcher Zitate registriert und kommentiert. Daß Brahms hiemit zunächst kein Neuland betrat, ist bekannt. Angesichts dessen, was wir über die beziehungsreiche Konstellation der Trias Schubert–Schumann–Brahms und ihren gemeinsamen Bezugspunkt Beethoven wissen, erstaunt es nicht, Brahms hier auf Pfaden wandeln zu sehen, die Schubert und Schumann vor ihm (unterschiedlich weit) gegangen waren.[xv] Die Beethoven-Reminiszenz in Schuberts Auf dem Strome (D 943)[xvi] ist eine der charakteristischen Markierungen am Anfang dieses Weges. Auch Schuberts auffällig zahlreiche Selbstanleihen dokumentieren ein erstes Stadium dieser Entwicklung.[xvii] Natürlich nimmt Schubert, wo er eigene Lieder im instrumentalen Gewand wiederverwendet, auch die Stimmungsebene des Textes sozusagen en passant wieder auf. Doch ein „wörtlicher Bezug“ im genaueren Sinn ist nicht das Ziel dieser Verwandlung. Schumann geht auf dem von Schubert vorgezeichneten Weg einen wichtigen Schritt weiter: Wenn Schumann eigene und fremde Vokalmusik zitiert, nützt er immer die ganze Botschaft des verschwiegenen Textes, und zwar immer in „hermetischer“ Weise. Ein besonders schönes Beispiel dieser intimen Kunst findet sich etwa im ersten Satz des Klaviertrios op. 80, wo die Melodie des zweiten Liedes aus dem Liederkreis op. 39 („Dein Bildnis wunderselig“) in einer schwärmerisch überhöhten Variante erscheint. Wie vertraut Brahms mit diesem Schumannschen Kunstgriff gewesen sein muß, zeigt das wohl berühmteste Doppelzitat der Musikgeschichte, nämlich das schon oben erwähnte Zitat aus Beethovens An die ferne Geliebte in der ersten Fassung des Klaviertrios op. 8. Schumann hatte die (durch die ihr bei Beethoven unterlegten Worte bedeutungschwere) Wendung gleichsam als Widmung an Clara in der Coda des ersten Satzes der Fantasie op. 17 zitiert (und sich in einer Reihe späterer Werke liebevoll dieses Zitates erinnert).[xviii] Die Wiederaufnahme dieses nun also schon mehrere Bedeutungs- und Erinnerungsebenen umspannenden Mottos als Kopfmotiv des Seitenthemas im Finalsatz des Klaviertrios, das Brahms in den Monaten nach der ersten Begegnung mit Robert und Clara Schumann komponierte, ist ein besonders berührender Beleg für die Möglichkeiten einer solchen über- und außermusikalische Bedeutungsebenen mit einbeziehenden Bezugnahme.
Bekanntlich fehlt dieser Bezug in der Endfassung des Werkes ebenso wie das nicht weniger suggestive Schubertzitat (Am Meer, D 957 Nr. 12) aus dem Adagio der Frühfassung. Da wenige Jahre vor der Umarbeitung des Werkes der erste Hinweis auf diese Zitate in der Brahmsliteratur nachweisbar ist[xix] hat man angenommen, daß die Eliminierung der durch diese „Demaskierung“ belasteten Bezüge einer der Hauptgründe für die Idee der Neufassung (die ja in Wahrheit eine Neukomposition wurde) gewesen sei.[xx] Eine solche Argumentation paßt sehr gut in das Bild des Meisters, der sich „nicht in die Lieder“ blicken lassen will. Allerdings läßt sich dann nicht leicht erklären, warum Brahms ausgerechnet im Jahr nach der öffentlichen „Entschlüsselung“ seiner auf Clara bezüglichen Beethoven-Schumann-Referenz eine gekürzte Fassung der verräterischen Wendung an prominenter Stelle im Finale der Vierten Symphonie (Takt 109-110) anbrachte.[xxi] Die Motive für das „Verschweigen“ jener zwei Zitate der Frühfassung des Klaviertrios, die durch ihre textlichen und biographischen Bezüge in besonderer Weise eine das persönliche Erleben des Komponisten berührende Deutung provozieren konnten und mußten, hat mit einiger Wahrscheinlichkeit auch persönliche Gründe gehabt; der wesentliche Anstoß für diese folgenschweren und weitreichenden Eingriffe in das Jugendwerk war aber wohl ein anderer.[xxii]
Brahms hatte in den Jahren seit der ersten Niederschrift des Werkes seinen musikalischen Umgang mit Zitaten in so bemerkenswerter und zielstrebiger Weise kontinuierlich verfeinert, daß ihm die Zitate der Frühfassung wohl „naiv“ erscheinen mußten. Wie wir aus den in sein Spätwerk reichlich eingeflossenen Zitaten wissen, lag ihm allerdings nichts ferner, als auf diese Dimension seiner Musik zu verzichten. Nur war ihm offensichtlich daran gelegen, diese Dimension zu einer rein musikalischen zu machen. Das erscheint im Zusammenhang mit dem Zitieren ursprünglich textgebundener Musik paradox: Ist nicht die dabei in Kauf genommene „Kontamination“ der Musik mit außermusikalischen Inhalten der wesentlichste Anreiz für diese Art des Zitates? Zweifellos; aber der Vorgang an sich weist doch auch in die entgegengesetzte Richtung: das vokale Zitat in instrumentaler Gestalt ist nämlich ganz unbestreitbar ein Schritt weg von der Wortsprache hin zur Tonsprache. Das verschwiegene Wort fließt in die Musik ein und bereichert sie von innen. In komplementärem Bezug auf die eingangs erwähnte Deutung des Zitates als Mittel zur „Überwindung der Sprachlosigkeit“ könnte man aus diesem Blickpunkt den Schritt von der wortgebundenen zur rein instrumentalen Musik als einen Akt der „Entsprachlichung“ sehen.[xxiii] Doch nicht Reduktion, sondern Sublimierung ist der Sinn dieser Übung. Das Traumziel ist, in der sehnsüchtigen Vision des Dichters:
„Erde, ist es nicht dies, was du willst: unsichtbar
in uns erstehen? – Ist es dein Traum nicht,
einmal unsichtbar zu sein? – Erde! unsichtbar!
Was, wenn Verwandlung nicht, ist dein drängender Auftrag?“[xxiv]
Indem der Mensch die Dinge benennt, verwandelt er sie. Wenn das Nennbare sich der Musik verbindet, entsteht eine neue, unsichtbare Welt. Das Wort, das sich schließlich in Musik gelöst hat, ist die erlösende Metamorphose dieser Welt des Säglichen. Solange aber die Worte in der Musik mitgehört werden, ist diese zweite Verwandlung noch nicht ganz vollzogen. Natürlich kennt Brahms, noch weit inniger als alle seine Hörer und Interpreten, den Zauber aller Zwischenstadien auf diesem Verwandlungswege: Seine lebenslange Liebe zum Lied beweist es. Aber entgegen der landläufigen Meinung, daß nämlich das Zitat zwangsläufig „über den Rahmen der reinen absoluten Musik hinausgeht“[xxv], scheint Brahms den Beweis antreten zu wollen, daß die Musik über die Kraft verfügt, das im Zitat gefangene Wort zu erlösen: Bei ihm nimmt die Musik – die eigene und die der Nächsten – die Sprache in sich auf, und das Wort geht restlos in Tönen auf.
Damit soll keineswegs geleugnet werden, daß die Worte, mit denen sich die Brahmsschen Motive zuerst verbunden haben, auch in der instrumentalen Verinnerlichung noch weiterleben. Das Auffinden solcher Bezüge wird daher erhellend bleiben. Doch, ganz als hätte Brahms unsere Neugier auch auf diesen Schleichpfaden schon erwartet, hinterläßt er uns auch auf diesem Weg recht unmißverständliche Botschaften. So zitiert er im Intermezzo h-moll op. 119 Nr. 1 den Beginn eines Liedes (op. 106 Nr. 4) mit dem Text:
„Wenn mein Herz beginnt zu klingen
Und den Tönen löst die Schwingen,
Schweben vor mir her und wieder
Bleiche Wonnen, unvergessen,
Und die Schatten von Cypressen.
Dunkel klingen meine Lieder!“[xxvi]
Der fast wie eine Warnung klingende Hinweis auf die „dunklen Lieder“ inmitten jener Werkgruppe (op. 116 bis op. 119), in der man eine letzte und unwiederholbare Manifestation des romantischen Topos der „Lieder ohne Worte“ sehen könnte, kommt wohl nicht von ungefähr. Aber trotz dieser sich auch noch in den allerletzten Werken manifestierenden Möglichkeit, den Wortsinn neben der musikalischen Metamorphose noch bestehen zu lassen, kann doch nichts darüber hinwegtäuschen, daß Brahms dieser Krücken schon lange nicht mehr bedarf. Für Brahms hat sich das „Problem“ Sprache und Musik gelöst.
Wenn Brahms, lange bevor sein körperlicher Verfall sich ankündigt, gezielt daran geht, sein Lebenswerk abzuschließen, muß das wohl im Wissen um ein erreichtes Ziel und eine gelöste Aufgabe geschehen. Vielleicht hat er selbst in der Antwort auf jene von Schubert und Schumann aufgeworfene Frage nach dem Schicksal des Wortes in der Musik diese Aufgabe gesehen?
Dieser wohl müßigen Spekulation steht unser klares Wissen gegenüber, daß Brahms in seiner Fähigkeit, die ganze äußere Welt in seine Musik aufgehen zu lassen, einen Endpunkt markiert. Die Selbstverständlichkeit, mit der sich hier unverwechselbar individuelle Chiffren und der vorgefundene Reichtum einer lange gewachsenen, beziehungsvollen Zeichensprache zu einem Idiom von seltener Klarheit verbinden, läßt die fast gleichzeitig entworfene programmatische Symbolsprache Wagners mit ihren lexikalisch starren Leitmotiven trotz aller unleugbaren Genialität rhetorisch und gesucht erscheinen. Daß das bei Brahms erzielte, verletzliche und auch hier immer bedrohte Gleichgewicht zwischen rührender Schlichtheit und erschütternder Vieldeutigkeit trotz seiner Ewigkeit verheißenden Monumentalität nur einen kurzen historischen Moment währen konnte, wird vielleicht nirgendwo so deutlich wie im Umgang der nachbrahmsischen Zeit mit dem Kunstmittel des Zitates: Was bei Brahms in Erfüllung eines von Schubert und Schumann gegebenen Versprechens unveräußerliches Zeichen einer geglückten Anverwandlung war, wird rasch wieder zu einem modischen und geistreichen Aufputz. Schon bei Richard Strauss ist das Zitat wieder nichts als Zutat – weltmännisch und selbstgefällig zubereitet und serviert. Nur noch etwa in den Selbstzitaten Mahlers findet sich ein träumerischer Reflex jenes Geistes, der das unangetretene Erbe von Brahms ist.[xxvii]
Mit der Kraft der Anverwandlung, die Wagner in seiner eingangs zitierten Attacke absichtsvoll als trickreiches Maskenspiel mißverstehen wollte, konnte Brahms seine Welt schlackenlos zu Musik machen. Die Bilder, Zeichen und Worte dieser Welt, die er zitiert, gehen in Musik ein – als wäre der zitierende Ruf eine Verheißung und Musik ein erlösender und befreiender Tod. (Die Spötter, die ihn „Das Grab ist meine Freude“ singen ließen, haben ihm vielleicht gar nicht so unrecht getan.) Ist es verwunderlich, daß ein Mensch, der so etwas vermag, Atheist ist?
Schon in seinen frühesten Liedern findet sich jene geheimnisvolle Kraft, die ihn vor allen Komponisten zum Vollzug dieser Verwandlung befähigt. Sie manifestiert sich immer wieder als „Eigen-Sinn“ der Musik, die in der Umsetzung der Textvorlage metrische und intonatorische Archetypen zur Wirkung bringt, anstatt sich deklamatorisch an den Text anzuschmiegen. Wer je den Versuch unternommen hat, etwa ein Lied von Hugo Wolf in einer Instrumentalfassung zu spielen, weiß, wie sehr der ganz aus der Sprache empfangene Geist dieser Musik sich gegen eine solche Beraubung sträubt. Daß das gleiche Experiment uns bei Brahms durchaus lebenskräftige und unentstellte Musik beschert, hat er uns schon in seinen Selbstzitaten bewiesen. Die oft kommentierten „Schwächen“ und „Mängel“ vieler von Brahms vertonter Texte, sind ganz sicher weder Ausdruck von Sorglosigkeit noch auch von schlechtem Geschmack – sie zeugen vor allem von der autonomen Kraft seiner Musik, die nur die Anregung durch ein Sprachbild sucht, das danach ruft, verwandelt zu werden.
Je weiter Brahms auf seinem Weg fortschreitet, umso vollendeter gelingt ihm diese Verwandlung. Zuletzt stehen wir vor einem Gewebe, das nichts als reinste Musik ist und doch die ganze Welt in sich trägt. Nicht zufällig hat Hull gerade in der Vierten Symphonie für seine beeindruckende und materialreiche Studie[xxviii] ein so fruchtbares Forschungsfeld gefunden. Die hier bewahrten Echos und Erinnerungen haben das wie immer auch berührend Anekdotische, das die Zitate der Jugendwerke noch preisgaben, weit hinter sich gelassen. Die zahlreichen „Clara“-Bezüge dieser Symphonie evozieren wohl nicht mehr das Bild der Geliebten, sondern sind selbst Musik gewordene Liebe. Die Zauberfäden dieses Gewebes bedürfen nicht mehr der Benennung, und sie umhüllen keinen Fremdkörper – sie sind eine in sich selbst schlüssige Botschaft.
[i] siehe z.B. Reinhard Schulz, „Das Zitat als Ausweg: Zur Überwindung der Sprachlosigkeit in der Neuen Musik mit Hinweisen auf B. A. Zimmermanns Musique pour les soupers du roi Ubu.“ in Festschrift. Rudolf Bockholdt zum 60. Geburtstag. Pfaffenhofen 1990.
[ii] Zofia Lissa, „Ästhetische Funktionen des musikalischen Zitates“, in Die Musikforschung XIX (1966), S. 165-167.
[iii] Kenneth Ross Hull, Brahms the allusive: Extra-compositional reference in the instrumental music of Johannes Brahms. Princeton University 1989, S.60ff.
[iv] Das Lied (auf ein Gedicht von Eichendorff) evoziert in Textur, Tonfall und Tonart (a-moll) Schumann, der für Brahmsens Eichendorff-Rezeption entscheidend war.
[v] Richard Wagner, „Über das Dichten und Komponieren“ (1879). Zitiert nach: Sämtliche Schriften und Dichtungen. Leipzig, s.a. (6. Auflage), Band X, S. 148.
[vi] ibidem S. 150.
[vii] Schumann arbeitete an seinen eigenen (zweihändigen)Variationen über dieses Thema vom 17. bis zum 27. Februar 1854.
[viii] Clara Schumann – Johannes Brahms. Briefe aus den Jahren 1853 – 1896. Im Auftrage von Marie Schumann herausgegeben von Berthold Litzmann. Leipzig 1927, Bd. I, S. 411.
[ix] Robert Schumann, Tagebücher. Band I, 1827 – 1838. Herausgegeben von Georg Eismann. Leipzig, 1971, S. 150f.
[x] Neben Friedrich Wieck ist auch der Cellist Andreas Grabau zugegen, der 1848 in der Uraufführung von Schumanns Klaviertrio op.63 spielte und dem Schumann dann 1851 seine Fünf Stücke im Volkston op.102 widmen sollte. Die Anwesenheit des umtriebigen Verlegers Heinrich Albert Probst, der mit fintenreicher Beharrlichkeit Schuberts Klaviertrio Es-Dur op.100 (D 929) für seinen jungen Verlag hatte erwerben können und nun das eben im Druck erschienene Werk mit Vaterstolz in die Leipziger Musiksalons einführte, ist ein humoristischer Kontrapunkt („von hinten u. von vorne“) zur geistigen Gegenwart Schuberts – und läßt uns an die beißende Verspottung der Verleger denken, die Wagner ein halbes Jahrhundert später zum Kernpunkt seines oben zitierten Aufsatzes machte.
[xi] Hingegen ist die Deutung, die Wolfgang Boetticher in der Einführung der von ihm offenbar unter ungünstigen Bedingungen und in größter Eile besorgten Erstveröffentlichung des Klavierquartetts (Wilhelmshaven 1979) einem Tagebucheintrag vom 30. Jänner 1830 (l. c., S.223) gibt – Boetticher spricht von einer „kammermusikalischen Krise“ –, offensichtlich eine für dieses Thema nicht atypische Fehl- und Überinterpretation: das „verunglükte Schub.[ertsche] Trio“, von dem Schumann da berichtet, ist ganz sicher kein Kompositionsversuch, sondern eine wohl wegen der zuvor genossenen Getränke („Rüdesheimer, […] Champagnerpunsch“) mißglückte Aufführung von Schuberts op.100.
[xii] also Zitate, die nicht so sehr Ausdruck und Produkt eines Gewebes von Querbezügen, sondern eine reflexhafte Anverwandlung bestehender Modelle sind. Dabei ist es an diesem Punkt unserer Überlegungen ohne Belang, ob Brahms diese Modelle wahrscheinlich bewußt (wie z.B. bei dem, den rhythmischen und gestischen Duktus des Incipits von Beethovens op.106 aufnehmenden, Anfang der Klaviersonate op.1) oder eher unbewußt (etwa in der bis zum Überdruß nachbeschworenen Meistersinger-Reminiszenz zu Beginn der Violinsonate op.100) zitiert.
[xiii] in Brahms als Liedkomponist. Studien zum Verhältnis von Text und Vertonung (Hrsg. Peter Jost). Stuttgart 1992, S. 39.
[xiv] Zu diesem Fragenkomplex vgl. z. B. Sabine Schutte, „Nationalhymnen und ihre Verarbeitung. Zur Funktion musikalischer Zitate und Anklänge“ in Das Argument, 1976, S.208-217.
[xv] Es mag wirklich sein, daß die von Schubert, Schumann und Brahms verwendeten Strategien der musikalischen Anspielung sich schon früher manifestiert haben, und unsere mangelnde Kenntnis dieser Erscheinungen ein Defizit der Forschung ist (wie Hull, op. cit., S.25, Anm. 2, meint). Doch spiegelt das Interesse der Musikwissenschaft an der Entwicklung des Phänomens gerade bei diesen Komponisten sicher auch den Umstand wider, daß es erst hier eine neue Qualität gewonnen hat.
[xvi] Rufus Hallmark, „Schubert´s Auf dem Strom“ in Schubert Studies. Problems of Style and Chronology. Eva Badura-Skoda (Hg.), Cambridge 1982, S.25-46.
[xvii] Diese Zitate sind weder „plakativ“ noch „hermetisch“; sie machen in der Regel eine im Lied gefundene Formulierung zum Ausgangspunkt einer variierenden Fortspinnung und Erweiterung: D 667/4 nach D 550 (Die Forelle), D 760/2 nach D 493 (Der Wanderer), D 802 nach D 795/18 (Trockene Blumen), D 810/2 nach D 531 (Der Tod und das Mädchen), D 934 nach D 741 (Sei mir gegrüßt).
[xviii] Die Beharrlichkeit, mit der Schumann zu diesem Thema zurückkehrt, läßt das Friedrich Schlegelsche Motto der Fantasie in eigenem Licht erscheinen:
„Durch alle Töne tönet
Im bunten Erdentraum
Ein leiser Ton gezogen
Für den, der heinlich lauscht.“
[xix] Hermann Kretzschmar in Grenzboten 1884 (in Buchform: Das deutsche Lied seit Schumann. Leipzig 1910)
[xx] Hull, op. cit. S.238-239.
[xxi] Hull, op. cit. S.210.
[xxii] Die Beweggründe für die Neukomposition des ersten Satzes wären gesondert zu erörtern. In diesem Satz hatte Brahms schon 1871 für die Wiener Erstaufführung des Werkes wesentliche Kürzungen vorgenommen.
[xxiii] Von der „Entsprachlichung musikalischer Phänomene“ spricht auch Siegfried Mauser in seinem Beitrag „Zum Sprachcharakter in der Neuen Musik“ (ÖMZ XLIX/6, 1994, S.364.) Daß der Vorgang bei Brahms seinem Wesen nach ganz anderer Natur ist als der hier konstatierte, muß wegen der andauernden Faszination von Brahms the progressive betont werden.
[xxiv] Rainer Maria Rilke, Neunte Duineser Elegie.
[xxv] Günther von Noé, Die Musik kommt mir äußerst bekannt vor. Wege und Abwege der Entlehnung. Wien, 1985, S.51.
[xxvi] „Meine Lieder“ von Adolf Frey
[xxvii] „Träumerisch“ durchaus im wörtlichen Sinn: Das Zitat ist, wenn es die Sphäre des Anekdotischen und Dekorativen verläßt, seinem Wesen nach dem Traum vergleichbar. Vgl. dazu Christopher Ballantine, „Charles Ives and the Meaning of Quotation in Music“ in The Musical Quartertly, LXV (April 1979), S.169f.
[xxviii] Hull, op. cit. S. 95-231.